DAS SICHTBARE UND DAS UNSICHTBARE.
Leiko Ikemura, Der Schrei | Micha Ullman, Seconda Casa
13. März 2016 bis 31 Oktober 2017
HELEN ESCOBEDO : DER AUSZUG. AUS MEXICO.
7. August bis 13. September 2016
ZEIG MIR WOHER DU KOMMST.
Dieter Mammel zeichnet mit Flüchtlingskindern.
29. Mai bis 7. August 2016
Berliner Dom
Am Lustgarten
10178 Berlin-Mitte
Öffnungszeiten: Außerhalb der Gottesdienste und Andachten täglich von 9.00 – 19.00 Uhr
Eintritt in den Dom (die gezeigten Kunstwerke sind Teil des gesamten Besuchsprogramms des Berliner Doms): 7,- Euro / erm. 5,- Euro
HELEN ESCOBEDO : DER AUSZUG. AUS MEXICO.
Predigt von Pfarrer Christoph Sigrist vom Grossmünster Zürich

Anfang der 2000er Jahre schuf die 2010 verstorbene mexikanische Künstlerin Helen Escobedo ihre große Installation ‚Los Refugiados‘ – ‚Die Flüchtlinge‘. Die aus Holz, farbigen Stoffresten und Draht gefertigten Skulpturen erinnern heute an die uns täglich begegnenden Film- und Fotoaufnahmen von Flüchtlingsströmen. Aber auch Bilder des im Alten Testament beschriebenen ‚Auszugs aus Ägypten‘ und anderer Völkerwanderungen werden als Teil des ikonografischen Weltgedächtnisses assoziiert.
Nun ziehen die lebensgroßen Figuren aus dem ‚Totentanz-Raum‘ der benachbarten St. Marienkirche in die Tauf- und Traukirche des Berliner Doms ein und werden dort zum Nachfolger der Präsentation der von Dieter Mammel gemeinsam mit Flüchtlingskindern gestalteten Installation ZEIG MIT WOHER DU KOMMST.
Entstand die jetzt im Dom gezeigte Skulpturengruppe einst für das Frauenmuseum Bonn, griff Escobedo – dieses Mal in Mexiko – das Thema ‚Flucht‘ erneut auf. Mit der aus 101 Figuren bestehenden Anordnung ‚Éxodos‘ schuf sie eine großformatige –formal gleiche Arbeit- die auf der Plaza Juárez vor der Alamada Central, im Zentrum der mexikanischen Hauptstadt präsentiert wurde und wie ein ‚Störfaktor‘ funktionierte.
Escobedo pflegte dauerhafte Beziehungen zwischen Mexico und Deutschland, zwischen Mexico City und Berlin.
Das nun im Berliner Dom ausgestellte Kunstwerk gilt als herausragendes Beispiel für das nachhaltige, auch soziale Engagement im Werk der Künstlerin und steht für ihre ‚mexikanisch-deutsche‘ Periode.
In Kooperation mit Peter Sötje, Yi Li und Marianne Pitzen/Frauenmuseum Bonn.
ZEIG MIR WOHER DU KOMMST.
Dieter Mammel zeichnet mit Flüchtlingskindern.
Predigt zur Eröffnung von Pfarrer Christhard-Georg Neubert
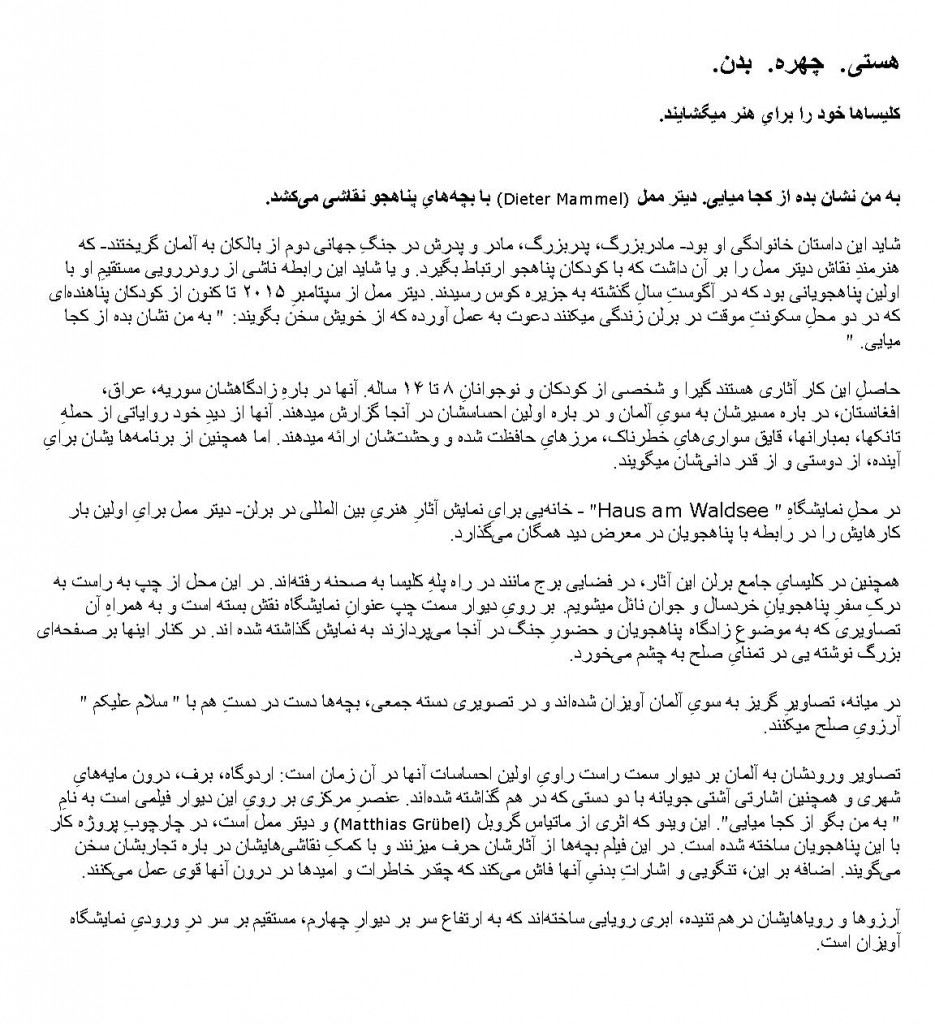
Übersetzung des deutschen Textes auf Farsi /german text translated to Farsi
Vielleicht war es seine eigene Familiengeschichte – die Großeltern und Eltern flohen im zweiten Weltkrieg vom Balkan nach Deutschland – die ihn, den Künstler Dieter Mammel bewegten, mit geflüchteten Kindern in Kontakt zu treten. Oder seine Begegnung mit ersten Flüchtlingen auf der Insel Kos im August letzten Jahres. Seit September 2015 lädt er in zwei Berliner Erstauf-nahmeeinrichtungen die Kinder ein, sich auf Papier zu artikulieren: „Zeig mir, woher du kommst“.
Entstanden sind eindrucksvolle persönliche Zeichnungen und Gemeinschaftsbilder der 8- bis 14-Jährigen. Sie berichten von ihrer Heimat, Syrien, dem Irak, Afghanistan, ihrem Weg nach Deutschland und ihren ersten Eindrücken vor Ort. Aus Kindersicht erzählen sie von Panzereinsätzen und Bombardierungen, von gefährlichen Bootsüberfahrten, bewachten Grenzen und ihren Ängsten. Aber auch von Zukunftsplänen, Freundschaft und Dankbarkeit.
Im Haus am Waldsee, einem Ort für internationale Kunst in Berlin, stellte Dieter Mammel seine Flüchtlingsarbeit erstmals der Öffentlichkeit vor.

Zeig mir woher du kommst. Ausstellungsansicht, Foto: Dieter Mammel.
Im Berliner Dom sind sie in einem eigens geschaffenen ‚Turm‘ im Treppenhaus inszeniert. In Leserichtung wird ihre Reise nachvollziehbar. Die linke Wand ist mit dem Ausstellungstitel versehen und zeigt Bilder, die ihre Herkunft und den dortigen Krieg thematisieren. Ein großes Blatt trägt die Bitte nach Frieden vor.
Mittig hängen Zeichnungen der Flucht nach Deutschland. Auf dem Gemeinschaftsbild halten sich die Kinder an den Händen und wünschen ‚Salam Alykum‘ – Frieden.
Bilder ihrer Ankunft erzählen auf der rechten Seite von ersten Eindrücken in Deutschland: Bettenlager, Schnee, Stadtmotiven sowie einer versöhnlichen Geste, zwei ineinandergelegte Hände. Zentrales Element der Wand ist der Film „Erzähl mir, woher Du kommst“. Das Video von Matthias Grübel und Dieter Mammel entstand im Rahmen dieses Projektes. Hier sprechen die Kinder über ihre Arbeiten. Die Zeichnung hilft Ihnen, über ihre Erfahrungen zu reden. Auch ihre Körpersprache verrät, wie sehr die Erinnerungen und Hoffnungen in ihnen arbeiten.
Ihre Wünsche und Träume sind zu einer großen Traumwolke verwoben und hängen über Kopfhöhe auf der vierten Wand, direkt über dem Eingang zur Ausstellung.
DAS SICHTBARE UND DAS UNSICHTBARE.
Mit Arbeiten von Leiko Ikemura, Gregor Gaida, Anastasia Khoroshilova, Young Hay und Micha Ullman
Predigt zur Eröffnung von Dompredigerin Petra Zimmermann
Rede zur Eröffnung von Kunsthistorikerin Mayen Beckmann

Ausstellungsansicht Berliner Dom: Young Hay, Bonjour Young Hay! (After Courbet), 1998, Palast der Republik, vorne: Gregor Gaida, Der Dornauszieher, beide Courtesy Privatsammlung Berlin, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016, Foto Marcus Schneider
Gregor Gaida, geboren 1975 im polnischen Industriegebiet Chorzów bei Katowice, verwendet für seine Skulpturen sehr unterschiedliche, auch oft unterschiedlich wertige Materialien. Seine Arbeit Der Dornauszieher bezieht sich auf Gustav Eberleins gleichnamige Skulptur von 1886, zu finden in unmittelbarer Nachbarschaft des Berliner Doms: Im Treppenhaus der Alten Nationalgalerie. Der Künstler Gregor Gaida transformiert den betulich anmutenden Jüngling Eberleins in eine raumgreifende, allansichtige, verstörende Skulptur. Der Corpus ist sehr nah am Vorbild, auch die Farbigkeit des weißen Marmors hat Gaida übernommen. Doch sein Dornauszieher ist auf den Torso reduziert und an drei Stellen aufgebrochen. Hohlräume klaffen auf, herbeigeführt durch riesige Stacheln, die nicht in den Körper hinein, sondern aus ihm herausführen. Sie durchbohren das Knie, den Rücken und deformieren selbst das Gesicht. Anders als sein Vorbild sitzt Gaidas Dornauszieher nicht auf einer Amphore: Er fällt nach hinten. Die Dornen stützen ihn.
Das Motiv des Dornausziehers ist aus der Antike überliefert, wie beispielsweise durch den berühmten ‚Spinario‘ in Rom. Ab dem 11. Jahrhundert eignet es sich das Christentum an und deutet es um. Der Dorn steht für die Erbsünde, die nach christlichem Glauben den Menschen seit der Vertreibung Adam und Evas aus dem Paradies anhaftet. Er galt das ganze Mittelalter hindurch als Strafe für diejenigen, die den tugendhaften Pfad verlassen haben (Hiob 30, 4ff.).
Bei Gaidas Dornauzieher wirkt der unbekleidete helle Körper – ein Symbol von Reinheit und Unschuld – porös und zerbrechlich. Dem gegenüber stehen die spitzen hölzernen Stachel. Der Blick in sie hinein wirft das eigene Spiegelbild zurück. Der Betrachter erkennt sich selbst in dieser Skulptur. Gaidas Skulpturen sind in ihrer Deutung nicht festgelegt und lassen weitreichende Assoziationen frei. Vom Spiel entgegengesetzter Kräfte im Yin-Yang- Prinzip über Luzifer, den gefallenen Engel, bis hin zum Märtyrer Sebastian, der durch Pfeile getötet werden sollte und gespickt mit diesen Eingang in die Bildtradition gefunden hat, bietet Der Dornauszieher ein großes Repertoire an persönlichen Anknüpfungspunkten.

Young Hay, Bonjour Young Hay! (After Courbet), 1998, Palast der Republik und Neue Wache, 120 x 161 cm, Fotografie, Courtesy Privatsammlung Berlin
Young Hay (*1963), ein in Hongkong lebender Chinese, hat sich Gustav Courbets 1854 entstandenes Gemälde Bonjour Monsieur Courbet genau angesehen. Es zeigt Courbet, vom Meer kommend, wie er auf zwei gut gekleidete Herren trifft, von denen einer möglicherweise der Auftraggeber des Bildes ist. Der Maler hat eine Staffelei und sein Malzeug auf dem Rücken geschultert und wandert scheinbar in der weitläufigen Landschaft auf der Suche nach einem Motiv. Für Young Hay sind alle Motive schon da. Alle Bilder sind vorhanden. 1995 begann er mit seiner Performance Bonjour Young Hay (Performance after Courbet), die ihn in alle Welt führen sollte. Am Anfang stand seine Heimatstadt Hongkong, eine urbane Landschaft, Straßenschluchten zwischen Wolkenkratzern. Voll der Neon-Reklamen, voll der Zeichen. In diese Zeichen setzte er ein weißes Rechteck. Eine leere Fläche.
Wie Courbet schulterte er eine Leinwand, eine Leinwand ohne Motiv, die er nicht bemalte. Er wanderte mit dieser Leinwand auf dem Rücken, einer Art ‚leerem Reklameschild‘ durch New York, Peking und 1998 durch Berlin. Dabei ließ er sich fotografieren. In Berlin war es der Künstler Christian Rothmann, der ihm assistierte. Young Hay besuchte die Gemäldegalerie, das Brandenburger Tor, die Friedrichstraße. Hinter der weißen Fläche wurden Geschichten sichtbar. Geschichten von Kunst und alter Malerei, Geschichten einer getrennten Stadt, die Geschichte einer ehemaligen Prachtstraße. Mit jedem Schritt des Künstlers änderte und ändert sich die Perspektive der Betrachter. Er besuchte den Berliner Dom und stand mit seiner Leinwand auf der großen Treppe zum zentralen Eingangsportal unter dem Bild im Bogenfeld darüber. Das Mosaik stammt von Arthur Kampf, einem Künstler der 1933 in die NSDAP eintrat, Juden diffamierte und den Adolf Hitler noch 1944 zum Gottbegnadeten ernannte, einer ‚Ehre‘ die neben ihm nur drei anderen Künstlern zuteilwurde.

Ausstellungsansicht Berliner Dom: Young Hay, Bonjour Young Hay! (After Courbet), 1998, Palast der Republik, vorne: Gregor Gaida, Der Dornauszieher, beide Courtesy Privatsammlung Berlin, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016, Foto Marcus Schneider
Young Hay überquerte fast ein Jahrhundert später die Straße und stellte sich mit seinem weißen Malgrund, der gleichsam alle Bilder der Umgebung fokussiert, vor den Palast der Republik. Genauer vor dem Bauzaun des zum Abriss frei gegebenen Gebäudes. Errichtet auf dem Grund des ehemaligen Berliner Stadtschlosses (und dessen zukünftiger Kopie) war das Gebäude Sitz der Volkskammer und öffentliches Kulturhaus der DDR. Auf Young Hays Foto wird hinter dem Bauzaun ein Stück der gläsernen Fassade und das von Hammer und Zirkel befreite Hoheitszeichen des untergegangenen totalitären Staates sichtbar. Auch hier eine leere Fläche. Diesmal rund und dunkel.

Young Hay, Bonjour Young Hay! (After Courbet), 1998, Neue Wache, 120 x 161 cm, Fotografie, Courtesy Privatsammlung Berlin
Das nächste Foto entstand in der Neuen Wache Unter den Linden. Der klassizistische Bau Karl Friedrich Schinkels diente bis zum Ende der Monarchie als Haupt- und Königswache, gleichzeitig auch von Beginn an als Memorial für Kriegsopfer. Je nach Regierung wandelte sich der Ort von einer Gedenkstätte für die Gefallenen der Befreiungskriege und der Napoleonischen Kriege zum Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus bis zur heutigen Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, die von dem damaligen Bundeskanzler Kohl eingerichtet wurde. Buchstäblich, gab es die ausgewählte Skulptur der expressionistischen Berliner Künstlerin Käthe Kollwitz doch nur als Miniatur, die auf Kohls Schreibtisch stand. Eine Pietà, eine trauernde Mutter mit ihrem Sohn, geschaffen von einer Mutter, deren Sohn Peter schon 1914 in den ersten Monaten des 1. Weltkriegs fiel. Ein Ereignis, das sie, die Tochter eines freikirchlichen Predigers, zur Pazifistin und Sozialistin werden ließ. Kohl beauftragte den Bildhauer Harald Haacke, eine überlebendgroße Kopie der Kollwitzschen Mutter mit totem Sohn anzufertigen.
Und so stellt Young Hays leere Leinwand auch die Frage nach der Wahrheit der Kunst. Die weiße Fläche strahlt auf die Leere im Innenraum der Schinkelschen Wache zurück und fragt so, unschuldig wie Kunst sein soll, nach dem Charakter unseres Gedenkens und dem Nicht-Genannten in unserer Erinnerung.

Ausstellungsansicht Berliner Dom: Leiko Ikemura, Der Schrei, Terrakotta, Courtesy Leiko Ikemura, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016, Foto Marcus Schneider
Leiko Ikemura ist Japanerin und lebt in Berlin. Sie studierte im spanischen Sevilla, lebte in der Schweiz, hatte eine Professur in Berlin. Wir erleben sie als eine internationale Künstlerin, eine großartige Malerin und Bildhauerin und doch: die japanische Kultur, ihre in Asien basierende Spiritualität bleibt sichtbar.Nun stellt Leiko Ikemura von ihr geschaffene Skulpturen im Berliner Dom aus. Oder genauer, sie installiert zart-farbige Keramiken in leeren Nischen, die so seit der Eröffnung des Berliner Doms in seiner heutigen Form, im Februar 1905, existieren. Es war damals wie heute: der Architekt Julius Carl Raschdorff überzog sein Budget, der Kaiser hatte kein Geld mehr, die Mäzene stiegen aus. Die mit vergoldeten Konsolen versehenen, mit dunklem Marmor ausgekleideten Nischen unter den Emporen und hinter der Kanzel blieben leer. Bis heute.

Ausstellungsansicht Berliner Dom: Leiko Ikemura, Der Schrei, Terrakotta, Courtesy Leiko Ikemura, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016, Foto Marcus Schneider
Die Figuren Ikemuras sind von Kopf bis Fuß mit bodenlagen Gewändern bekleidet. Individuelle Details fehlen ebenso wie das Gesicht. Dort, wo wir sonst ein Gesicht sehen, schaut ein großes schwarzes Loch uns an. Eine schreiende, alles verschlingende Öffnung, die an den aufgerissenen Mund einer Figur aus dem Lebensfries von Edvard Munch erinnert. Und nicht nur an diesen weltbekannten Schrei erinnert sie, vielmehr auch an Frauen, Körper und Gesichter von Frauen, die über das Meer kommen, die hunderte Kilometer zu Fuß kommen, Frauen mit leeren Gesichtern, die uns täglich im Bildschirm entgegen sehen.
Doch ist die Kleidung an Ikemuras Skulpturen nicht ‚zur Flucht‘ geeignet. Lange Gewänder verdecken Körper die oft aussehen wie gequält und in sich gedreht. Bodenlange Gewänder, mit Schleiern versehen, wie heilige Frauen sie tragen. Heilige Frauen, die Diskriminierung, Marter und Gewalt erlebten und erleben wie Millionen Frauen in aller Welt jeden Tag auf jedem Kontinent. Und trotz ihres Schreis, die Skulpturen Ikemuras zeigen Haltung und Würde. Eine Haltung wie wir sie von den Virgines capitales , den vorzüglichen Jungfrauen, kennen und wie wir sie im dem Dom benachbarten Bode-Museum finden. Bildwerke christlicher Märtyrerinnen: Katharina, Barbara, Margaretha und Dorothea, die die katholische Kirche heiligsprach und die von der evangelischen Kirche immer noch mit Gedenktagen bedacht sind. Heilige Frauen, die in der westlichen Bildtradition stets makellos und schön dargestellt wurden, obwohl sie zu Lebzeiten Folterqualen erlitten. Wie Barbara, die im libanesischen Helopios gegeißelt und verstümmelt und anschließend von ihrem Vater enthauptet wurde, weil sie sich zu Christus bekannte. Auch Katharina wird im Bode-Museum in einem 1480 geschaffenen Relief kurz vor ihrer Enthauptung nach ihren Martern als die Edle, die Andächtige, die Besonnene dargestellt.
Und so schwiegen die bildlichen Darstellungen durch viele Jahrhunderte über den Schmerz. Es blieb eine Leerstelle, wie die Nischen im Dom Leerstellen bilden. Darum werden sie in Teilen auch leer bleiben, andererseits im von Kaiser Wilhelm dem Zweiten initiierten ‚Männerdom‘ erstmals Skulpturen von Frauen zeigen und so über die Situation aller Frauen reflektieren. Aus der Nähe betrachtet zeigen Ikemuras Skulpturen Spuren genannter Verletzungen und Verstümmelungen. Ein Körper ist durchlöchert, der zweite zeigt Striemen, ein Arm ist abgerissen. Und doch haben sie sich von der Idee westlicher Kunst weit entfernt.
Das japanische Wabi-Sabi Prinzip, eine Idee über Schönheit und eng mit dem Buddhismus verbunden, verknüpft sich in Leiko Ikemuras Arbeit mit dem westlichen Bildgedächtnis und füllt dessen Leerstellen auf. Das Asymmetrische, das Raue und Unregelmäßige, das Einfache und Unvollständige, aus der sich die Ästhetik Ikemuras entwickelt, trifft auf die strengen und doch oft kopierenden, zitierenden und damit nicht originären Konstruktionsprinzipien des Berliner Doms. Leiko Ikemuras Arbeit schaffen Reflektionsflächen. Fragen an die christliche Glaubensgeschichte tun sich auf.

Anastasia Khoroshilova, Die Übrigen, 2014, 36 x 28 cm, C-Print, Courtesy Galerie Volker Diehl
Die meisten Arbeiten Anastasia Khoroshilovas, z.B. The Obedient (2008), Starie Novosti (2011), People without a territory (2011), entstehen aus Begegnungen mit ‚einfachen‘ Menschen. Oftmals von der Öffentlichkeit Ungehörte, denen die Künstlerin mittels Film und Fotografie eine Stimme gibt. Sie spürt verlorengehende Erinnerungen auf und verleiht ihnen erneutes Gewicht. 1978 in Moskau geboren, beschäftigt sich die Fotografin mit der Vergänglichkeit des kollektiven Gedächtnisses und benutzt die Kunst als eine Form der Recherche.
Zusammen mit der deutschen Journalistin Annabel von Gemmingen reist Khoroshilova 25 Jahre nach dem Mauerfall und dem Zerfall der Sowjetunion nach Lettland, um das Schicksal von Kriegsveteranen zu erforschen. Sie treffen Letten, die auf deutscher oder russischer Seite kämpften und russischsprachige Veteranen, die als Staatenlose in Lettland leben. Einstmals für ihre Verdienste auf dem Schlachtfeld hoch dekoriert, sind sie heute ,die Übrigen‘. Gemeinsam mit der Berliner Autorin und Kuratorin Anne Maier geben Khoroshilova und von Gemmingen ein bebildertes Buch heraus.

Ausstellungsansicht Berliner Dom: Anastasia Khoroshilova, Die Übrigen, Courtesy Galerie Volker Diehl, Foto © Marcus Schneider
Zwischen Fotos von Uniformjacken, lettischer Landschaft und eines Privatmuseums mit Exponaten aus dem II. Weltkrieg sticht ein Einzelbild heraus: Zu sehen ist Haut. Fast schon hyperrealistisch, ungeschönt in all ihren Farbnuancen und Strukturfacetten. Weiße alte Haut mit Sommersprossen, Leberflecken, Muttermalen und einer Narbe. Inzwischen verwachsen. Aufgrund ihrer Form und Größe sowie dem gewählten Anschnitt ist zu vermuten, dass es sich um eine Schusswunde im rechten Schulterblatt handelte. Obwohl inzwischen verheilt, zeugt sie dennoch lebenslänglich von der Gewalt und Todesgefahr des Krieges.
Gleich einer Ikone steht die kleinformatige Fotografie auf dem Altar der Tauf- und Traukirche des Berliner Doms. Die Narbe erinnert an die Seitenwunde Jesu Christi, die ihm am Kreuz zugefügt wurde. Die Verletzlichkeit und Abtötung seines Körpers galt den Schächern als Beweis des Mensch-Seins, der nicht göttlichen Natur des ‚Königs der Juden‘. Insbesondere in der Mystik des Hochmittelalters fand die Seitenwunde eine besondere Verehrung und damit einhergehend eine Vielfalt an Darstellungsformen. Der in der Romanik über den Kreuzestod triumphierende Christus wird in der Gotik als leidender Mensch mit blutender Seitenwunde dargestellt. Dieses Motiv ist sowohl als lebensgroßer Kruzifixus als ‚Kruzifix aus Pisa‘ aus dem 14. Jhd oder als das um 1425 geschaffene Kruzifix von Antonio Bonvicino im benachbarten Bode-Museum zu sehen. Die Arbeit der russischen Künstlerin Anastasia Khorshilova bringt die Seitenwunde in den Dom zurück.

Micha Ullman, seconda casa 2004, Basalt-Lava, Wasser, 55 x 35 x 4 cm, Courtesy Privatsammlung Berlin
Zwei Häuser berühren sich am Dachfirst. Kopf an Kopf sind sie als Negativabdruck in eine graue Gesteinsplatte aus Basalt-Lava eingelassen. Durch Wasser werden sie gleichermaßen verbunden und ausgefüllt. Hier ist die Natur, die Energie des Fließenden, das überbrückende Element zweier sich gegenüberstehender Kräfte. Sie ermöglicht die Koexistenz der Gegensätze, das Aushalten des ewigen Umbruchs, gleich einer beständigen Wasseruhr. Der israelische Künstler Micha Ullman bezeichnet diese kleinen, naturgebundenen Skulpturen als Minimente, den großen, einen Wichtigkeitsanspruch vertretenden Monumenten entgegengesetzt.
Das kleine Werk, in den Fliesen-Boden unter der Kanzel eingelassen, abstrahiert Ullmans Seconda Casa, Jerusalem-Rom. Auch dieses ist in den Boden eingelassen, ins Pflaster der Piazza Monte de Savello in Rom, gelegen am Rande des ehemaligen jüdischen Ghettos. Die Häuser liegen auf einer Achse, die von Rom nach Jerusalem führt. Der Titel Zweites Haus meint im Hebräischen den zweiten Tempel der Juden in Jerusalem. Der Tempel wurde um 70 nach Christus vom römischen Heerführer Titus 70 n. Chr. belagert und zerstört. Die Römer bauten Titus einen Triumphbogen, in dessen direkter Nachbarschaft sich Ullmans Arbeit befindet.
Die Zerstörung des Tempels löste das weltweite Exil der Juden aus, eine Situation, die bis heute andauert. Seconda Casa erinnert so auch an die zweitausend italienischen Juden, die am 27. Januar 1943 aus dem schon erwähnten Ghetto in die Konzentrationslager deportiert wurden. Bei Regen füllen sich die Häuser. Das Wasser reflektiert die Umgebung, den Himmel, die Passanten und – so man sich darauf einlässt – den Betrachter.
Micha Ullman ist als israelischer Künstler auch Berliner. Zahlreiche Arbeiten in der Stadt wurden von ihm geschaffen: Die Bibliothek als Denkmal an die Bücherverbrennung auf dem Bebelplatz, die Skulptur Niemand gegenüber dem Jüdischen Museum, das Mahnmal Blatt auf dem Grundriss einer von den Nazis verbrannten Synagoge und – seit Kurzem- an der Ecke Unter den Linden/Spandauer Straße das Haus , das an den großen Philosophen der Aufklärung, an Moses Mendelssohn, der dort und nur einen Steinwurf vom Dom entfernt wohnte.
Die Berliner Version von Seconda Casa liegt unter der Kanzel in den Boden der Solnhofener Platten eingelassen. Ullmans Arbeit schaut in Richtung des Hauses des Philosophen. Aber auch einer in die Wand eingelassenen Tafel. Zur Ehrung der im ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten. Die vom Hof- und Domprediger Bruno Doehring mit einer großen Predigt in diesen Krieg geschickt wurden. Einer Predigt, gehalten auf dieser Kanzel.
Die Skulpturen von Leiko Ikemura und Micha Ullman bleiben vorläufig bis zum 31. Juli 2016 installiert.
Zur Baugeschichte des Berliner Domes
Der Berliner Dom wird am 27. Februar 1905 nach elfjähriger Bauzeit feierlich eingeweiht. Der Bauzeit voraus gehen zahlreiche Planungen für ein Bauwerk, welches zugleich Kirche und Nationaldenkmal ist. Der schließlich seit 1891 vorliegende, gestalterisch äußerst komplexe Entwurf mit über fünfhundert Räumen wird in enger Zusammenarbeit mit dem jeweils regierenden Deutschen Kaiser – der zugleich König von Preußen und summus episcopus der evangelischen Kirche ist – vom Architekten Julius Carl Raschdorff entwickelt. Raschdorff gelingt mit dem Bauwerk, welches er im Alter von 82 Jahren abschließt, ein Hauptwerk des internationalen Historismus. Eine umfangreiche Ausstellung zur Bau- und Planungsgeschichte befindet sich im Dom–Museum im Obergeschoss des Berliner Domes.
Am 26. Mai 1944 wird die Kuppellaterne des Berliner Domes von einer Brandbombe getroffen. Die viele Tonnen schwere Laterne fällt darauf hin durch den zentralen Kirchenraum, zerschlägt den Fußboden der Predigtkirche und landet schließlich in der Gruft. Das kreisrunde Loch, was im Scheitel der Kuppel zurückbleibt, wird erst Anfang der fünfziger Jahre mit einem Notdach verschlossen. Im September 1945 findet in der provisorisch dafür hergerichteten Gruft der erste Gottesdienst im kriegszerstörten Bauwerk statt. Es folgen fast drei Jahrzehnte, in denen zahlreiche Vorschläge für den Wiederaufbau des Domes vorgestellt werden. Erst 1974 wird ein Vertrag zwischen dem Außenhandelsunternehmen Limex der DDR und dem Bund der evangelischen Kirchen in der DDR geschlossen, der die Grundlage des von 1975 bis 1993 durchgeführten Wiederaufbaus des Berliner Domes bildet. Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt durch die Bundesrepublik Deutschland und die westdeutsche Evangelische Kirche Deutschlands. Im ersten Bauabschnitt wird die halbrunde, im Norden an den zentralen Kirchraum anschließende Denkmalskirche, die dem Gedenken an die Hohenzollern gewidmet war, ebenso wie die im Süden befindliche Kaiserliche Unterfahrt, abgerissen. Das übrige Bauwerk wird weitgehend nach historischem Vorbild wiederhergestellt. Vor allem beim Wiederaufbau der Innenräume in den Jahren 1983 bis 1993 bemüht man sich, den überlieferten Bauformen so nah wie möglich zu kommen.
Am 06. Juni 1993 wird der Berliner Dom feierlich wiedereingeweiht und seitdem wieder ähnlich genutzt wie vor seiner Zerstörung: als Kirche, als Ort für Staatsakte, als Veranstaltungsort, als Sehenswürdigkeit und als Heimat einer aktiven und wachsenden Gemeinde. Mit über 700.000 Besuchern im Jahr ist der Berliner Dom eines der meistbesuchten Häuser in Berlin. Seine vielschichtige Baugestalt macht ihn zu einem authentischen Denkmal, an dem der Glaube und die Hoffnungen vorangegangener Generationen ebenso ablesbar sind, wie deren Irrtümer und Enttäuschungen.
Text Baugeschichte: Charlotte Hopf, Dombaumeisterin
LIST OF ARTISTS
Leiko Ikemura | Gregor Gaida | Anastasia Khoroshilova | Young Hay | Micha Ullman